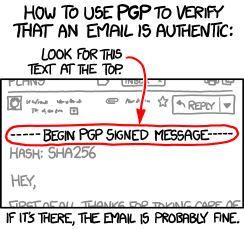Die Bundesregierung hat den Entwurf des E-Government-Gesetzes in den Bundestag eingebracht und hierbei auf die Bedenken und Änderungswünsche des Bundesrates reagiert.
Den hier bereits angesprochenen Vorbehalten des Bundesrates tritt die Bundesregierung so gut wie vollständig entgegen.
So lehnt der Bundesrat eine weitergehende Verpflichtung der Länder und Kommunen ab, den elektronischen Rechtsverkehr zuzulassen. Seine Forderung, aus dem „muss“ des § 2 Abs. 1 E-GovG ein „kann“ zu machen (Nr. 8 a), weist die Bundesregierung zurück: Eine solche Regelung sei angesichts von § 3a Abs. 1 VwVfG entbehrlich, nach dem die Behörden schon jetzt können, wenn sie wollen. Die koordinierte Zulassung im Bund wie in den Ländern ermögliche eine ebenenübergreifende Behördenkommunikation.
Für die Forderung des Bundesrates, der Bund möge die Länder und Kommunen wenigstens für die Mehrkosten entschädigen (Nr. 8 b), sieht die Bundesregierung keine Grundlage in der Finanzverfassung des Grundgesetzes. Danach trägt jede Verwaltungseinheit ihre eigenen Kosten selbst, Art. 104a Abs. 5 GG.
Sodann fordert der Bundesrat eine Vorschrift, die die Behörden verpflichten soll, die Bürger über die technischen Eigenarten von De-Mail aufzuklären. Es müsse darauf hingewiesen werden, „dass das von der Behörde übersandte elektronische Dokument nicht aus dem Zusammenhang mit der De-Mail-Nachricht, mit der es versandt wurde, herausgelöst werden darf, weil ansonsten die Signierfunktion verloren geht“ (Nr. 16).
Die Bundesregierung sieht hierfür keine Notwendigkeit. Zum einen sei der De-Mail-Anbieter aus § 9 De-Mail-Gesetz zur Aufklärung der Nutzer verpflichtet. Dabei müsse er auch hierauf hinweisen. Zum anderen könnten die Behörden, die das für notwendig erachteten, auch ohne eine solche Vorschrift auf alles Mögliche hinweisen.
Auch der Forderung des Bundesrates nach einer technikneutralen Formulierung in § 3a Abs. 2 VwVfG (Nr. 17) weist die Bundesregierung zurück. Es sei notwendig, jedenfalls aber vorzugswüdrig, die sicheren Techniken in den Gesetzestext aufzunehmen. Andere sichere als die derzeit bekannten Techniken seien nicht bekannt. Falls sich das ändern sollte, könne hierauf bei der Evaulierung des Gesetzes reagiert werden. Nur hilfsweise schlägt sie eine Verordnungsermächtigung vor.
Lediglich die Forderung des Bundesrates, Behörden müssten auf einen per De-Mail gestellten Antrag auf gleichem Wege antworten können, verspricht die Bundesregierung zu prüfen (Nr. 15).
Bundestags-Drucksache 17/11473 mit Stellungnahme des Bundesrates und Erwiderung der Bundesregierung.
Im Kommentar: Zum Inhalt der Aufklärungspflicht des De-Mail-Anbieters nach § 9 De-Mail-G siehe K § 9 Rdnr. 12 ff.